Bildung zwischen Demokratieauftrag und Chancengerechtigkeit
Über Demokratiebildung, Religionsunterricht und das Kopftuchverbot ist am Montagabend (22. September) in Wien kontrovers diskutiert worden: Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) und Maria Habersack, Vorstandsvorsitzende der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, stellten sich bei der dritten Ausgabe des neuen Dialog-Formats "KA-Salon" der Katholischen Aktion Österreich (KAÖ) Fragen rund um aktuelle Herausforderungen im Schulsystem. Notwendig sei eine stärkere Demokratiebildung, um Schülerinnen und Schülern mehr Mitbestimmung und Partizipation zu ermöglichen, sowie eine Verbesserung der Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen, lautete der Tenor.
Am Bild (v.l.n.r.): Thomas Immervoll, Vizepräsident der KAÖ, Maria Habersack, Vorstandsvorsitzende der Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, Christoph Wiederkehr, Bildungsminister, Rafael Haigermoser, ehrenamtlicher Vorsitzender der Katholischen Jugend Österreich, Ferdinand Kaineder, Präsident der KAÖ © KAÖ
Als "extrem schwierig abzuwägen" bezeichnete Wiederkehr hingegen das von der Koalition im Regierungsprogramm vorgesehene Kopftuchverbot für Jugendliche unter 14 Jahren. Es gehe hierbei um das Spannungsverhältnis zwischen Religionsfreiheit und dem Schutz von Mädchen. "Die Mehrheitsauffassung der Bundesregierung war, dass das Tragen von Kopftuch, insbesondere in der Volksschule, ein Zeichen der Unterdrückung der Frau ist und nicht von einem freiwilligen Tragen gesprochen werden kann", erklärte der Minister. Daher habe man entschieden, "dass wir diese Mädchen bis zum Alter von 14 Jahren schützen sollen". Mit 14 beginne die Religionsmündigkeit, und junge Frauen könnten "selbstbestimmte Entscheidungen" treffen.
Auch wenn es sich laut Wiederkehr um eine teils symbolisch aufgeladene Debatte handelt, sei der Druck auf Mädchen eine gesellschaftliche Realität. "Dass es kein Problem ist, kann man nicht behaupten", so der Politiker.
Habersack sprach hingegen von einer "sehr populistisch geführten Diskussion" und betonte, Demokratieerziehung müsse alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von religiösen Symbolen einbeziehen.
Selbstermächtigung und Verantwortung
Einigkeit herrschte darin, dass Demokratiebildung in der Schule über einen reinen Fachunterricht hinausgehen müsse. Wiederkehr plädierte für mehr Autonomie, um neue Modelle zu erproben: "Möglichst viele Entscheidungen lokal treffen, eigene Selbstermächtigung erfüllen, selber spüren: Ich habe in einer Demokratie etwas zu sagen."
Habersack verband Partizipation aber auch mit Verantwortung: "Wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich auch die Verantwortung dafür übernehmen. Das ist für mich ganz zentral." Fraglich bleibe aber, "ob in einem noch immer sehr stark hierarchisch strukturierten System, und das Bildungssystem ist es nach wie vor, Demokratieerziehung möglich ist", so die ehemalige Direktorin einer Ausbildungsstätte für Elementarpädagogik.
Demokratie sei "nicht etwas, was ich kognitiv vermitteln kann, sondern Demokratie ist ein Prozess, ist eine Haltung, setzt eine Haltung voraus", so Habersack weiter. Schulen müssten daher Räume schaffen, "wo Schüler und Schülerinnen, Kinder und Jugendliche Möglichkeiten vorfinden, um ihre demokratiepolitischen Haltungen entwickeln zu können". Demokratiebildung könne "nur ein durchgängiges Unterrichtsprinzip sein, in allen Gegenständen, in allen Fächern".
Wiederkehr sah letztlich einen "Kulturwandel im Schulsystem" vonnöten. Die Schule sei historisch auf Wissensvermittlung und Disziplin angelegt gewesen, heute gehe es um Kompetenzen. "Eine ganz relevante Kompetenz im 21. Jahrhundert ist die Demokratiefähigkeit, nämlich Themen kritisch hinterfragen zu können und den eigenen Verstand zu verwenden", so der vormalige Wiener Bildungsstadtrat. Demokratie müsse "begreifbar und erlebbar" gemacht werden, etwa durch Debattierklubs oder Projekte mit "echter Beteiligung". Zugleich sprach sich Wiederkehr für eine stärkere institutionelle Verankerung aus: "Andere Länder haben 'Citizen Education' fest verankert. Auch in Österreich braucht es einen Ort, wo Demokratie nicht nur theoretisch vermittelt, sondern praktisch erfahrbar wird." Wiederkehr sprach sich dabei auch aus für mehr Autonomie, um neue Schul- oder Unterrichtsmodelle zu erproben.
Zu frühe Selektion
Kritik übten Habersack wie Wiederkehr an der frühen Trennung von Schülerinnen und Schülern nach der vierten Klasse Volksschule, wo sich die Bildungswege in Mittelschule oder Gymnasien aufteilten. Diese Selektion fördere die Chancenungleichheit im Bildungssystem, die letztlich noch immer durch den soziokulturellen Hintergrund der Kinder bestimmt werde. "Das zeigt sich auch daran, wer sich an Gymnasien die Nachhilfe leisten kann und wer nicht", nannte Habersack als Beispiel.
"Die Entwicklung der Talente muss unabhängig von Herkunft, Einkommen der Eltern oder Erstsprache möglich sein", betonte Wiederkehr, der für sich dabei für eine Stärkung der Elementarpädagogik aussprach. In einer "hyperdiversen" Gesellschaft gehe es zudem um gemeinsame Werte. Hierbei habe der Religionsunterricht eine wichtige Aufgabe, "aber nicht nur dieser allein".
Bildungspolitik sei immer auch Teil einer ideologisch aufgeladenen gesellschaftspolitischen Debatte, gab der Minister zu bedenken. Ziel müsse letztlich aber immer Bildungsgerechtigkeit sein.
Gesellschaftspolitisch relevante Themen
Die KAÖ hatte im Mai mit dem "KA-Salon" ein neues Dialogformat gestartet. Dabei werden jeweils Fachleute zu Themenbereichen eingeladen, in denen sich die Katholische Aktion gesellschaftspolitisch einbringen will. Der erste KA-Salon unter dem Titel "Brot, Wein und Demokratie" am 12. Mai hatte sich der Frage gewidmet, welche Verantwortung Christinnen und Christen für das Wohl der Demokratie haben. Die Gesprächsabende werden nun in den Landeshauptstädten zu den Themen "Bibel" (November, St. Pölten), "Arbeitswelt" (Linz) und "Kunst" (Steiermark) fortgesetzt. Alle Veranstaltungen sind öffentlich zugänglich.
Quelle: kathpress
Siehe das KAÖ-Dossier Demokratie leben und gestalten

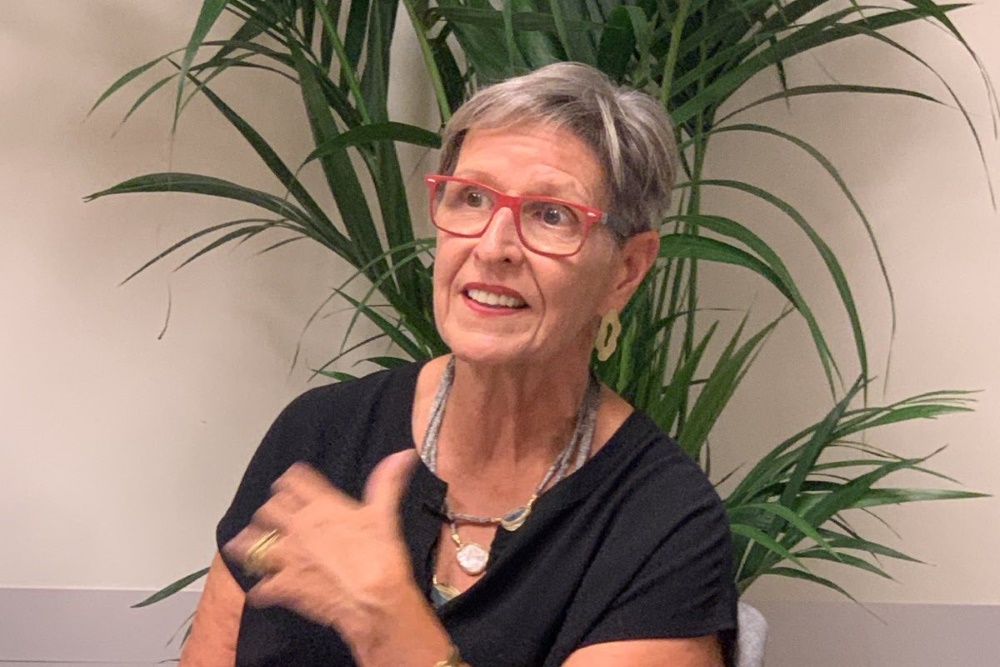

(ps/23.9.2025)

